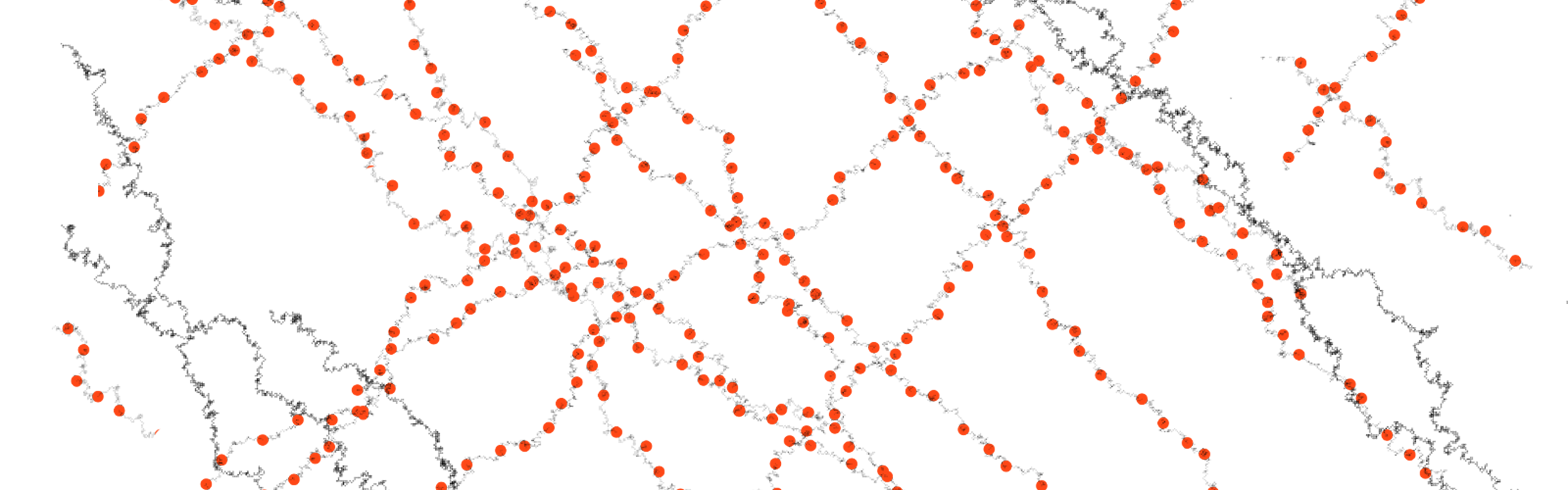-
In diesem Kapitel der Arbeit werden die Ergebnisse der Arbeit diskutiert und interpretiert.
Zuerst sollen die zuvor zusammengestellten Ergebnisse der einzelnen Hypothesen getrennt voneinander in Abschnitt 7.1 erörtert werden. Im Anschluss steht erfolgt eine Diskussion der wichtigsten Ergebnisse der Delphi-Befragung in Abschnitt 7.2. Abschließend soll auf mögliche Limitationen und Kritik bei der Befragung der Experten in Abschnitt 7.3 eingegangen werden.
7.1 Interpretation der Hypothesen
Die getrennte Interpretation und die Zusammenfassung der einzelnen Hypothesen stehen im Mittelpunkt dieses Abschnitts. Die Reihenfolge der Thesen wird aus Kapitel 1 übernommen. Im ersten Abschnitt 7.1.1 findet eine Beantwortung der ersten Hypothese statt. Sie beschreibt Aspekte der KI, die zum Erfolg des UI-Designers maßgeblich beitragen. Im Zentrum des zweiten Abschnitts 7.1.2 befindet sich die zweite These, die die Verlagerung des Tätigkeitsbereichs des UI-Designers in den Mittelpunkt stellt. Abschließend wird auf die dritte Hypothese eingegangen, die näher auf den Ersatz des UI-Designers durch die KI eingeht. Alle drei Hypothesen werden auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft. Die Hypothesen werden verifiziert oder falsifiziert.7.1.1 Beantwortung der ersten Hypothese
Um eine Veränderung des Tätigkeitsfeldes des UI-Designers im zukünftigen Alltag zu identifizieren, wurde mit dem Ziel der Verbesserung dieser Vorhersage eine qualitative und klassische Mini-Delphi-Befragung durchgeführt. Es wurde in der ersten Hypothese angenommen, dass bestimmte Aspekte der KI einen positiven Einfluss auf den UI-Designer ausüben. Dafür wurde ein Fragebogen an neun Experten in der ersten Befragungswelle und fünf Personen in der zweiten Welle verschickt. Um die Qualität der Delphi-Befragung gewährleisten zu können, wurden die drei Gütekriterien der qualitativen Forschung eingehalten. Die Kriterien sind Transparenz, Intersubjektivität und Reichweite der Forschung.
Die an die Hypothese gestellten Erwartungen konnten in der Auswertung der Delphi-Befragung verifiziert werden. Von den Experten haben 44,4 % schon einmal mit KI gearbeitet und verzeichneten Auswirkungen auf den Tätigkeitsbereich, die im Anschluss ausgewertet wurden. Die Experten der beiden Befragungsrunden gaben in offenen Fragestellungen Aspekte für eine erfolgreiche Benutzung von KI an. Im Zentrum standen Effizienzsteigerungen sowie ein besseres und schnelleres Arbeiten.
Anzumerken ist dabei jedoch, dass die inhaltsanalytische Auswertung der offenen Fragestellungen gezeigt hat, dass KI negative Einflüsse auf die Gestaltung von UIs haben kann. Sieben Experten in der ersten Befragungsrunde gaben einen Verlust der Individualität des Designs an, wenn KI beginnt, Interfaces zu gestalten. Bereits in Abschnitt 2.3.5 wurde auf die Wichtigkeit eines benutzerorientierten und individuellen Designs eingegangen.7.1.2 Beantwortung der zweiten Hypothese
In der zweiten Hypothese wurde davon ausgegangen, dass sich der Tätigkeitsbereich des UI-Designers durch die vermehrte Benutzung von KI verlagern wird. Die Erwartungen konnten durch die quantitativen Daten sowie die inhaltsanalytische Auswertung der befragten Experten verifiziert werden.
Die Experten beschrieben, wie in Abschnitt 2.4 erläutert, einen wahrscheinlichen Wandel von einer Übertragung von Aufgaben bis hin zur Unterstützung durch die KI. Diese Zusammenarbeit würde sich noch stärker als die in der ersten Hypothese beschriebenen positiven Erfolgsfaktoren auf den UI-Designer auswirken, da Aufgaben noch schneller und besser bewältigt werden könnten.
Dennoch sind die dargestellten Ergebnisse mit Bedacht zu sehen. In der ersten Befragungswelle gaben 55,6 % der neun Experten an, noch nicht mit KI gearbeitet zu haben. Vier Aussagen der befragten Experten aus dem Abschnitt 5.2.4 bestätigen diesen Sinngehalt. Die Experten gaben im ersten Fragebogen an, dass die Entwicklung der KI noch am Anfang steht.7.1.3 Beantwortung der dritten Hypothese
In der dritten Hypothese wurde angenommen, dass der UI-Designer durch KI ersetzt wird. Die Erwartungen an die gestellte Hypothese konnten durch die befragten Experten einerseits verifiziert und andererseits falsifiziert werden.
Die Zeitintervalle der Szenarien in der Fragestellung [D1] waren ausschlaggebend für das Ergebnis. Das Trägheits-Szenario beschreibt keine Veränderungen im Tätigkeitsbereich des UI-Designers. Die Experten stimmten für das Eintreffen des Szenarios bis zum Jahr 2030. Alle neun Experten der ersten Befragungsrunde unterstrichen diese Erkenntnis in einer separaten Fragestellung, in der sie es für eher bis sehr unwahrscheinlich hielten, dass der UI-Designer bis zum Jahr 2030 ersetzt wird. In dieser zweiten Fragestellung [D2] wurde gezielt nach einem Zeitintervall bis 2030 für eine wahrscheinliche Übernahme der KI gefragt. Als Impuls kann die Szenario-Studie der SmartAIwork, die in Abschnitt 3.2 genauer behandelt wurde, genannt werden. Sie datierte eine mögliche Veränderung in der Sachbearbeitung bis zum Jahr 2030. Darauf aufbauend wurden in den darauffolgenden Abschnitten die Veränderungen im Tätigkeitsfeld des UI-Designers in vier Szenarien beschrieben und das mögliche Zeitintervall wurde beibehalten. Als Resultat kann festgehalten werden, dass es laut der in dieser Masterarbeit dargestellten Forschungsergebnisse zu keinen Veränderungen im Tätigkeitsbereich des UI-Designers bis ins Jahr 2030 kommen wird.
Sowohl das Automations-Szenario als auch das Ambivalenz-Szenario bewahrheiten sich laut der Experten bis zum Jahr 2035. In ihnen wird das Personalmanagement durch eine KI ersetzt und der UI-Designer wird beim Entwerfen und Recherchieren unterstützt. Die Experten waren sich einig, dass eine vollständige Übernahme des Tätigkeitsbereichs des UI-Designers durch die KI bis zum Jahr 2050 geschehen könnte. In diesem Zeitintervall tritt das Transformations-Szenario in Kraft, das sich sowohl unterstützend als auch ersetzend auf die Tätigkeiten des Designers auswirkt.7.2 Limitationen und Kritik
- Eine Limitation kann in den Methoden-Richtlinien einer Delphi-Befragung mit qualitati-vem Forschungsanteil gefunden werden.139 Dabei können besonders fehlende Anhalts-punkte für eine rein qualitative Analyse bemängelt werden.
- 139Vgl. Brady, Shane: Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research, in: International Journal of Qualitative Methods, Bd. 14, Nr. 5, 2015, S. 1–2, doi:10.1177/1609406915621381.
- Qualitätskriterien für eine qualitative Delphi-Befragung sind Teil der Forschung.140 Es wurden nach Diamond et al. vier Schlüsselindikatoren für ein Delphi zusammengefasst:
- 140Vgl. Diamond, Ivan u. a.: Defining consensus: A systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies, in: Journal of Clinical Epidemiology, Bd. 67, Nr. 4, 2014, S. 402–403, doi:10.1016/j.jclinepi.2013.12.002.
-
- Sie beschreiben Angaben von Abbruchkriterien,
- eine geplante und festgelegte Anzahl von Runden,
- reproduzierbare Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer
- und Kriterien für das Auslassen von Fragestellungen bei jeder Runde.
- Um eine schnelle Erreichbarkeit der Experten, zeitliche Unabhängigkeit und die Umsetzung der Delphi-Befragung gewährleisten zu können, wurde eine digitale Variante dem klassischen, schriftlich-postalischen Vorgehen nach Häder141 vorgezogen. Eine mögliche Kritik kann an der digitalen Umsetzung der Delphi-Methode geäußert werden.
- 141Vgl. Häder, 2014, S. 127–138.
- Der Fragebogen wurde zunächst in Microsoft Word entwickelt und die Formulare wurden anschließend in Adobe Acrobat vorbereitet. Ein Problem zeigte sich bei den ersten zurückgeschickten Fragebögen. Der PDF-Fragebogen musste bei dieser Methode ausschließlich in Adobe Acrobat beantwortet werden. Anderenfalls gingen die Angaben der Experten beim Versenden verloren. Nach drei zurückgeschickten Fragebögen ohne Inhalt wurde das Problem erkannt, das Word-Dokument angepasst und erneut mit Formularen versehen. Durch diesen nicht erfolgten Hinweis gingen Angaben der Experten verloren, die den Fragebogen nicht erneut ausfüllten. Auf der ersten Seite des Fragebogens und bei der Kontaktaufnahme wurden die Experten dann darauf hingewiesen, dass der Fragebogen in Adobe Acrobat auszufüllen sei.
- 139Vgl. Brady, Shane: Utilizing and Adapting the Delphi Method for Use in Qualitative Research, in: International Journal of Qualitative Methods, Bd. 14, Nr. 5, 2015, S. 1–2, doi:10.1177/1609406915621381.
- 140Vgl. Diamond, Ivan u. a.: Defining consensus: A systematic review recommends methodologic criteria for reporting of Delphi studies, in: Journal of Clinical Epidemiology, Bd. 67, Nr. 4, 2014, S. 402–403, doi:10.1016/j.jclinepi.2013.12.002.
- 141Vgl. Häder, 2014, S. 127–138.