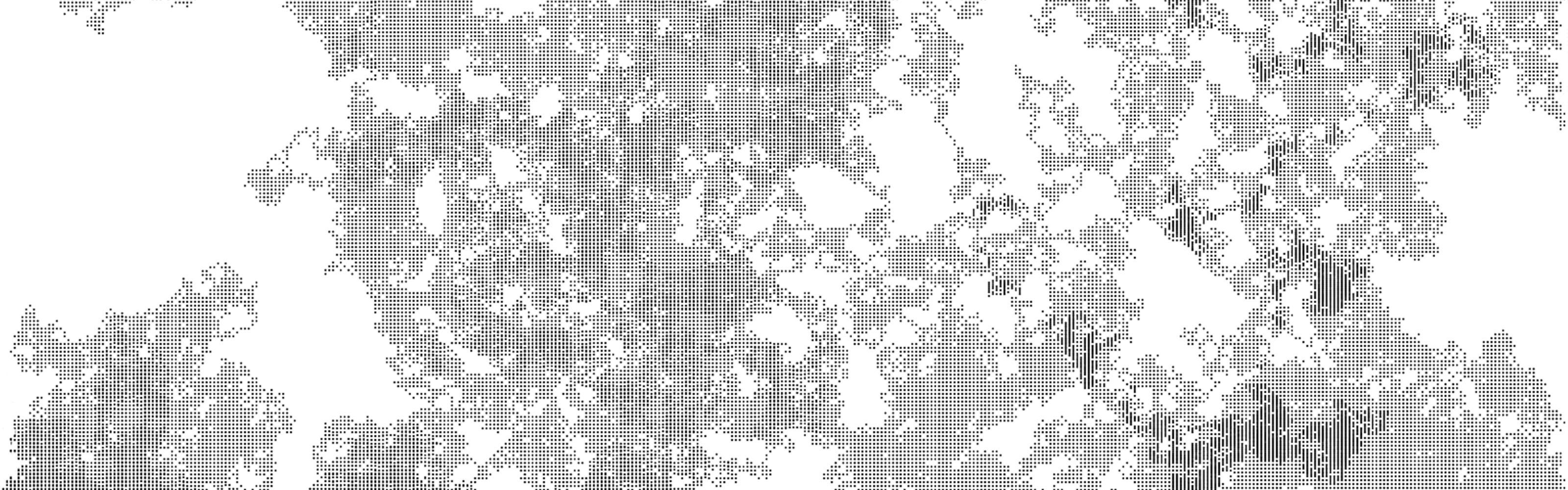- Ängste und Fantasien werden bei Menschen durch die künstliche Intelligenz (KI) hervorgerufen. Fortschritte bei der Entwicklung von intelligenten Anwendungen und außergewöhnlichen Modellen werden täglich durch Forscherteams verkündet. Die Frequenz ihrer Ankündigungen lässt vermuten, dass an und mithilfe der Schlüsseltechnologie erneut geforscht wird.
- KI wird in verschiedenen Tätigkeitsbereichen verwendet, um dem Menschen die Arbeit zu erleichtern. Bereits in den Bereichen der Automobilindustrie und im Gesundheitswesen sind die Auswirkungen der KI deutlich. Während das autonome Fahren weiter erforscht und optimiert wird, war die globale Pandemie SARS-Covid-19 der Auslöser für die Entwicklung einer KI, die frühzeitig Lungen von Covid-19 erkrankten Menschen erkennt. 1
- 1Vgl. Kaplan, Hamilton/Aaron Kaplan: Covid-19-classifier, in: Blog labs.deep-insights.ai, 24.04.2020, https://labs.deep-insights.ai [20.06.2021].
- Der zukünftige Stellenwert der KI im User-Interface-Design (UI-Design) kann nur erahnt werden. Im Bereich des UI-Designs ließ Abrahamis Ankündigung einer KI, die Teilbereiche von Web-Interfaces gestalten kann, die Design-Community aufmerksam werden.2 In der aktuellen Forschung wurde über Intelligenz und Kreativität im Zusammenhang mit dem UI-Designer und der KI sowie über einen sich verändernden Tätigkeitsbereich unzureichend diskutiert.
- 2Vgl. Abrahami, Avishai: Wix ADI | Wix CEO Avishai Abrahami Launches Artificial-Design-Intelligence, in: YouTube, 2016, Abschn. 6:50–13:15, www.youtube.com/watch?v=8qzx9lfcSRs [08.06.2021]
- Menzel und Winkler beschreiben in ihrer Literaturübersicht aus dem Jahr 2018 mögliche Beschäftigungseffekte durch die KI.3 Bei ihren Untersuchungen kommen sie bei der Mehrheit der Studien zu dem Ergebnis, dass das Automatisierungsrisiko von der Art der beruflichen Tätigkeit abhängt. Kreative und intelligente Tätigkeiten sind nicht von der Automatisierung durch die KI betroffen und führen zu keinem Beschäftigungsverlust. Mögliche Veränderungen durch die KI am Tätigkeitsbereich des UI-Designers bleiben jedoch weitestgehend unerforscht.
- 3Vgl. Menzel, Christoph/Christian Winkler: Zur Diskussion der Effekte Künstlicher Intelligenz in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur in: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2018, S. 6–8, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Diskussionspapiere/20190205-diskussionspapier-effekte-kuenstlicher-intelligenz-in-der-wirtschaftswissenschaftlichen-literatur.pdf [15.09.2021].
- Die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz kommt in ihrem Bericht aus dem Jahr 2020 zu einem ähnlichen Ergebnis wie Menzel und Winkler.4 Die Kommission führt an, dass derzeit unzureichende Forschungsergebnisse vorliegen, um die Auswirkungen der KI auf den Arbeitsmarkt zu beschreiben. Sie gehen davon aus, dass für den Menschen gefährliche, körperlich schwere sowie wiederkehrende Arbeiten von der KI unterstützt und reduziert werden. Weiterhin verweist die Kommission auf die Prognose von Frey und Osborne aus dem Jahr 2013.5 Sie prognostizieren einen Abbau von 47 % der US-Arbeitsplätze durch KI.
-
4Vgl. Unterrichtung der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwor-tung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale (Drucksache 19/23700), in: D Server Bundestag, 2020, S. 306–309, https://dserver.bundestag.de/btd/19/237/1923700.pdf [15.09.2021].
5Vgl. Frey, Carl/Michaela Osborne: The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, in: Oxford Martin School, 2013, S. 1, https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf [27.04.2021].
- Brzeski und Burk bauten auf dieser Studie auf und übertrugen die Ergebnisse auf die Situation in Deutschland.6 Sie kamen zu dem Ergebnis, dass 59 % der Arbeitsplätze in ihrer jetzigen Form bedroht seien. Beide Studien berücksichtigen nicht den UI-Designer oder zeigen Veränderungen auf.
- 6Vgl. Berski, Carsten/Inga Burg: Die Roboter kommen (doch nicht?). Folgen der Automatisierung für den deutschen Arbeitsmarkt – eine Bestandsaufnahme, in: ING DiBa, 2018, S. 1, https://www.ing.de/binaries/content/assets/pdf/ueber-uns/presse/carsten-brzeskis-blog/2018/ing-diba-economic-analysis-roboter-2-0-final.pdf [15.09.2021].
-
1.1 Forschungsfrage
Im Rahmen dieser Arbeit wird folgender Forschungsfrage nachgegangen: Wie verändert sich das Tätigkeitsfeld des UI-Designers? Es wird das Ziel verfolgt, die aktuellen sowie die zukünftigen Auswirkungen der KI auf den Beruf des UI-Designers zu untersuchen. Dabei werden beide Bereiche definiert und genauer beleuchtet. Unter Zuhilfenahme von Zukunftsaussichten in Form von Szenarien soll der Tätigkeitsbereich des UI-Designers beschrieben werden. Um die Forschungsfrage zu beantworten, werden drei Hypothesen aufgestellt, auf die schrittweise eingegangen werden soll. Den Ausgangspunkt bildet die erste gerichtete Hypothese: „KI besitzt Erfolgsfaktoren, die dem Designer nützen können.“ Hypothetisch wird dabei angenommen, dass KI positive Eigenschaften besitzt, um den Arbeitsalltag des UI-Designers produktiver und effektiver zu gestalten. Die zweite Hypothese lautet: „Je mehr KI benutzt wird, desto mehr verlagert sich der Tätigkeitsbereich des UI-Designers.“ Es wird vermutet, dass die KI dem Designer in einer Form der Zusammenarbeit unterstützt. Die dritte Hypothese lautet: „Der UI-Designer wird von KI ersetzt.“ Abschließend wird dargelegt, ob der UI-Designer der Zukunft seinen Platz im Berufsfeld verliert oder ob er verstärkte Kooperationen mit der KI eingeht. Weder in der Arbeit noch in den Szenarien werden utopische Vorstellungen beschrieben. Beispielhaft kann KI wie HAL 9000 oder Samantha aus den Filmen „A Space Odyssey“ oder „Her“ genannt werden. Sie sind zu komplexen Tätigkeiten imstande und wenden sich gegen den Menschen. In diesen Filmen werden die biologischen Grenzen des Menschen überwunden.1.2 Ziel und Vorgehensweise der Arbeit
Die Masterarbeit verfolgt das Ziel, die Auswirkungen der KI auf den Tätigkeitsbereich des UI-Designers zu untersuchen und mithilfe des Trägheits-, Automations-, Ambivalenz- und Transformations-Szenarios mögliche Prognosen zu erstellen. In Thesen umgewandelt werden sie den Experten vorgelegt, die sie in mögliche Zeitintervalle des Eintretens einteilen sollen. Um das Ziel zu erreichen und die Forschungsfrage der Masterarbeit zu beantworten, wird eine klassische und qualitative Mini-Delphi-Befragung durchgeführt. Mithilfe dieser Methodik werden Bewertungen, Meinungen und Kriterien für zukünftige Entwicklungen aufgezeigt. Im Zentrum der Methodik stehen eine Bestimmung und Verbesserung der Vorhersage über die Veränderungen des Tätigkeitsfeldes des UI-Designers und eine mehrheitliche Urteilsbildung der befragten Experten. In einem standardisierten Fragebogen mit ergänzenden offenen Formulierungen zur Verbesserung der Validität, sollen die Experten in zwei Befragungswellen ihre Expertisen zu dem Thema darlegen. Die Auswertung der offenen und geschlossenen Fragen wird voneinander getrennt vorgenommen. Die quantitativen Daten werden mithilfe des Medians, des Modus und dem arithmetischen Mittel untersucht. Die offenen Fragen werden einer inhaltsanalytischen Auswertung unterzogen, um so ein optimiertes Textverständnis der Expertenkommentare zu erzielen. -
Der Aufbau dieser Arbeit ist an eine partizipative Technikfolgenabschätzung nach Kornwachs angelehnt und umfasst acht Kapitel.7 Grunwald argumentiert, dass die Prognose nach Kornwachs neben dem Strukturmodell nach Schuchardt und Wolf zu den meistzitierten Idealmodellen einer Technikfolgenabschätzung gehört.8 9 Dabei muss berücksichtigt werden, dass es für die Durchführung dieser Art von Prognosen kein allgemeingültiges Konzept gibt. Die Abschätzung nach Kornwachs enthält eine feste Struktur, bestehend aus sechs obligatorischen Arbeitsschritten, die jeweils in Unterschritte untergliedert sind. Die Elemente sind: Vorbereitende Maßnahmen, Feststellen des Ist-Zustands, Systemanalyse, Validierung, Prognose und Bewertung. Kornwachs definiert den Begriff der Technikfolgenabschätzung als eine „systematische und breite Erforschung der Entwicklung von Technologien, ihren individuellen, organisatorischen und gesellschaftlichen sowie weiteren technologischen Auswirkungen und Folgen.“10 Diese Prognosetechnik ermöglicht es, Schlüsseltechnologien mithilfe von Szenarienentwürfen oder möglichen Zukunftsentwicklungen zu strukturieren und einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen.
-
7Vgl. Kornwachs, Klaus: Glanz und Elend der Technikfolgenabschätzung, in: Klaus Kornwachs (Hrsg.), Reichweite und Potenzial der Technikfolgenabschätzung, Stuttgart: Hanser, 1991, S. 8.
8Vgl. Ropohl, Günter/Wilgart Schuchardt: Schlüsseltexte der Technikbewertung, (ILS-Taschenbücher), Dortmund: ILS, 1990, S. 20–38.
9Vgl. Grunwald, Armin: Technikfolgenabschätzung: eine Einführung (Gesellschaft, Technik, Umwelt, N. F., 1), 2., grundlegend überarbeitete und wesentlich erweiterte Aufl., Berlin: Springer, 2010, S. 122.
10Bullinger, Hans-Jörg: Technikpotenzialabschätzung – Wissenschaftlicher Anspruch und Wirklichkeit, in: Klaus Kornwachs (Hrsg.), Reichweite und Potenzial der Technikfolgenabschätzung, Stuttgart: Nomos, 1991, S. 105.
- Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden vorbereitende Maßnahmen erläutert, um die Zielsetzung und die Problematik zu erläutern. Im zweiten Kapitel wird der Ist-Zustand festgelegt. Dabei werden die künstliche Intelligenz, das User-Interface sowie der UI-Designer näher beschrieben. Weiterhin wird auf Kooperationsformen wie die generative Gestaltung und die Koevolution eingegangen. Ein Vergleich der KI in den Bereichen der Automobilindustrie und des Gesundheitswesens beschließt das Kapitel. Darauf aufbauend wird im dritten Kapitel eine Systemanalyse durchgeführt. Es wird genauer auf das Potenzial der KI-bestimmenden Größen der Wirtschaft und der Politik eingegangen. Darüber hinaus werden vier Zukunftsaussichten in Form von Szenarien entwickelt. Im Fokus des vierten Kapitels steht die Methodik der empirischen Untersuchung des Themas. Die Beschreibung der Erhebungsmethode, die Auswahl der befragten Experten und eine Aufbereitung und Auswertung werden in diesem Kapitel näher erläutert. Anschließend werden im fünften und sechsten Kapitel die Ergebnisse der beiden Delphi-Befragungsrunden dargestellt. Die Kapitel werden jeweils in die Schilderung der quantitativen Ergebnisse und die Resultate der inhaltsanalytischen Auswertungen unterteilt. Im siebten Kapitel werden die Ergebnisse der beiden Befragungsrunden den Hypothesen zugeordnet. Darüber hinaus werden die drei geschilderten Hypothesen beantwortet, Limitationen und Kritik diskutiert und interpretiert. Mit dem Fazit im achten Kapitel wird die Arbeit abgeschlossen.
1.3 Gliederung
- 1Vgl. Kaplan, Hamilton/Aaron Kaplan: Covid-19-classifier, in: Blog labs.deep-insights.ai, 24.04.2020, https://labs.deep-insights.ai [20.06.2021].
- 2Vgl. Abrahami, Avishai: Wix ADI | Wix CEO Avishai Abrahami Launches Artificial-Design-Intelligence, in: YouTube, 2016, Abschn. 6:50–13:15, www.youtube.com/watch?v=8qzx9lfcSRs [08.06.2021].
- 3Vgl. Menzel, Christoph/Christian Winkler: Zur Diskussion der Effekte Künstlicher Intelligenz in der wirtschaftswissenschaftlichen Literatur in: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 2018, S. 6–8, https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Diskussionspapiere/20190205-diskussionspapier-effekte-kuenstlicher-intelligenz-in-der-wirtschaftswissenschaftlichen-literatur.pdf [15.09.2021].
- 4Vgl. Unterrichtung der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwor-tung und wirtschaftliche, soziale und ökologische Potenziale (Drucksache 19/23700), in: D Server Bundestag, 2020, S. 306–309, https://dserver.bundestag.de/btd/19/237/1923700.pdf [15.09.2021].
- 5Vgl. Frey, Carl/Michaela Osborne: The Future of Employment: How susceptible are jobs to computerisation?, in: Oxford Martin School, 2013, S. 1, https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/future-of-employment.pdf [27.04.2021].
- 6Vgl. Berski, Carsten/Inga Burg: Die Roboter kommen. Folgen der Automatisierung für den deutschen Arbeitsmarkt, in: ING DiBa, https://www.ing-diba.de/pdf/ueber-uns/presse/publikationen/ing-diba-economic-research-die-roboter-kommen.pdf [15.09.2021].
- 7Vgl. Kornwachs, Klaus: Glanz und Elend der Technikfolgenabschätzung, in: Klaus Kornwachs (Hrsg.), Reichweite und Potenzial der Technikfolgenabschätzung, Stuttgart: Hanser, 1991, S. 8.
- 8Vgl. Ropohl, Günter/Wilgart Schuchardt: Schlüsseltexte der Technikbewertung, (ILS-Taschenbücher), Dortmund: ILS, 1990, S. 20–38.
- 9Vgl. Grunwald, Armin: Technikfolgenabschätzung: eine Einführung (Gesellschaft, Technik, Umwelt, N. F., 1), 2., grundlegend überarbeitete und wesentlich erweiterte Aufl., Berlin: Springer, 2010, S. 122.
- 10Bullinger, Hans-Jörg: Technikpotenzialabschätzung – Wissenschaftlicher Anspruch und Wirklichkeit, in: Klaus Kornwachs (Hrsg.), Reichweite und Potenzial der Technikfolgenabschätzung, Stuttgart: Nomos, 1991, S. 105.